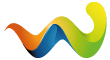Spiegelbild des jugendlichen Zeitgeists Die Musiksendung, die die Jugendkultur revolutionierte: „Beat-Club“ wird 60
Rebellion im Minirock: Vor 60 Jahren, am 25. September 1965, startete die legendäre Musiksendung „Beat-Club“. Sie spiegelte das Lebensgefühl der jungen Generation wider – mit Rockgrößen wie Jimi Hendrix oder Led Zeppelin. Ein Blick zurück.
Lange Haare, kurze Röcke: In der legendären Musiksendung „Beat-Club“ war der jugendliche Zeitgeist zu Hause wie sonst nirgendwo im deutschen Fernsehen. In der Liveshow gaben sich Superstars und weltberühmte Rockgruppen wie Jimi Hendrix, The Who, Santana oder Deep Purple die Ehre. Sie begeisterten die vielen jungen Zuschauer, sodass der „Beat-Club“ am Samstagnachmittag zu einem Riesenerfolg wurde, zunächst in Schwarz-Weiß, später in Farbe. Vor 60 Jahren, am 25. September 1965, startete der „Beat-Club“ im deutschen Fernsehen und wurde schon bald zu einer TV-Institution, die damals das Lebensgefühl einer modernen und rebellischen Jugend in der Bundesrepublik wie keine andere Sendung widerspiegelte.
Der „Beat-Club“ von Radio Bremen begann mit einer ungewöhnlichen Ansage: „In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im deutschen Fernsehen, die nur für euch gemacht ist“, wandte sich ARD-Sprecher Wilhelm Wieben an die „lieben Beat-Freunde“ und besänftigte zur Sicherheit die älteren Zuschauer mit den Worten: „Sie aber, meine Damen und Herren, die Sie Beat-Musik nicht mögen, bitten wir um Ihr Verständnis. Es ist eine Live-Sendung mit jungen Leuten für junge Leute.“
Tatsächlich ließ der Protest der Elterngeneration, für die das Showspektakel „Zum Blauen Bock“ damals der Gipfel flotter Fernsehunterhaltung war, nicht lange auf sich warten. Von empörendem Kulturverfall, „Hottentotten-Musik“ und erschreckender Sittenlosigkeit war die Rede, der „Beat-Club“, in einem nur 300 Quadratmeter großen Garagenstudio mitten in einem Bremer Wohngebiet produziert, galt als Lieblingssendung der „Gammler“ und Aufrührer, schmeckte nach „Rauschgift“ und Revolution.
Seine jungen Fans machten sich freilich wenig aus derlei Kritik, im Gegenteil: „Das gehörte uns. Wir konnten uns darüber definieren“, erzählt etwa Wolfgang Niedecken, der damals ein Teenager war und später die enorm erfolgreiche Kölschrock-Band BAP gründen sollte. Regelmäßig sollen mehr als 60 Prozent der Zuschauer unter 30 Jahren den „Beat-Club“ eingeschaltet haben, dazu exportierte Radio Bremen die Musikshow in zahlreiche Länder, darunter Finnland und Tansania.
Moderiert wurde die Live-Sendung vor Publikum von der jungen Studentin Uschi Nerke, die zu Anfang meist die Auftritte von Bands ansagte, die gerade auf Deutschland-Tournee waren und einen Abstecher ins Bremer Garagenstudio machten. Die damals 21 Jahre alte Architekturstudentin und angehende Sängerin faszinierte die jungen Zuschauer und Zuschauerinnen primär mit ihren rebellischen Klamotten: Ihre Miniröcke und Lackstiefel machten die junge Frau zur Mode-Ikone der deutschen Sixties. In den ersten Folgen wurde Moderatorin Nerke noch von dem Bremer Discjockey Gerd Augustin unterstützt, der das Konzept für den „Beat-Club“ gemeinsam mit Michael Leckebusch von Radio Bremen entwickelt hatte.
Die von 1965 bis 1972 laufende Show wurde einmal im Monat ausgestrahlt und dauerte anfangs nur 30 Minuten, die Sendezeit wurde wegen der gigantischen Einschaltquoten beim jungen Publikum aber 1968 auf eine Stunde verdoppelt. Die Anmutung eines anfangs eher biederen Bühnenambientes mit brav tanzenden Teenagern wurde im Lauf der Jahre zudem von immer mehr knallbunten visuellen Effekten abgelöst – psychedelische Bilder hielten wie auch anderswo in Film und Fernsehen beim „Beat-Club“ Einzug.
Als sich der enorme Erfolg der Sendung unter Managern und Künstlern überall auf der Welt herumgesprochen hatte, kamen auch immer mehr internationale Stars. So liest sich die Gästeliste des „Beat-Club“ fast wie ein „Who is Who“ der damaligen Rock- und Bluesszene, auf ihr finden sich Namen wie Joe Cocker, Steppenwolf, Led Zeppelin, The Doors, Frank Zappa, The Cream mit Eric Clapton oder Muddy Waters. Die weltberühmten Beatles und die Rolling Stones kamen allerdings nicht für einen Live-Auftritt nach Bremen. 1972 wurde jedoch aus Montreux eine Spezialausgabe des „Beat-Clubs“ gesendet, bei der die Stones auftraten.
Pete Townshend von The Who, die unter anderem ihren späteren Megahit „My Generation“ zum Besten gaben, zertrümmerte sogar standesgemäß seine Gitarre bei einem Auftritt der britischen Rockformation im „Beat-Club“. Hinter der Bühne seien er, Roger Daltrey und die anderen Mitglieder der Band aber sehr höflich gewesen und hätten brav in der Kantine auf ihren Einsatz gewartet, erinnerte sich Uschi Nerke später. Auch deutsche Bands wie The Lords oder The Rattles, deren Sänger Achim Reichel in einer dicken Fellweste die Bühne betrat, spielten im Bremer Studio. Anfangs gab es 500 Mark Honorar für einen Auftritt, das viele Gruppen aber sogleich in Bier und Schnaps umsetzten, sodass von der Gage am Ende nicht viel übrig blieb. So manche Band habe sich bei der Abrechnung nach Abzug aller Alkoholkosten mit fünf Mark zufriedengeben müssen, besagt eine der zahlreichen Legenden rund um die Kultsendung.
Mit der Dokumentation „The Beat Goes On – 60 Jahre Beat-Club“ würdigt das NDR-Fernsehen am 4. Oktober um 21.45 Uhr die legendäre Musikshow. Sänger Max Mutzke nimmt den Zuschauer mit auf eine klingende Zeitreise in die 60er-Jahre: Musiker wie Peter Maffay oder Wolfgang Niedecken erinnern sich in der Sendung daran, wie sie als Teenager auch mithilfe des „Beat-Club“ eine ganz neue Welt für sich entdeckten. Gezeigt werden legendäre Szenen aus dem Archiv von Radio Bremen, prominente Musiker und Musikerinnen wie Campino, Jan Delay oder Klaus Meine von den Scorpions huldigen dem „Beat-Club“.